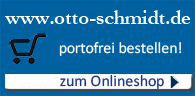BGH v. 20.11.2024 - XII ZB 78/24
Minderjährigenunterhalt: Keine Herabsetzung des notwendigen Selbstbehalts bei einer Wohn- oder Haushaltsgemeinschaft mit einem Dritten
Anders als beim Zusammenleben des Unterhaltspflichtigen mit einem Ehegatten oder Partner in nichtehelicher Lebensgemeinschaft ist die Herabsetzung des notwendigen Selbstbehalts bei einer Wohn- oder Haushaltsgemeinschaft mit einem Dritten nicht gerechtfertigt. Der im Jahr 2022 gezahlte Kinderbonus ist als Bestandteil des Kindergelds gem. § 1612 b Abs. 1 BGB bedarfsmindernd anzurechnen, bei Betreuung eines minderjährigen Kindes durch einen Elternteil mithin zur Hälfte.
Der Sachverhalt:
Die im Juli 2015 geborenen Antragsteller machen gegen die Antragsgegnerin, ihre Mutter, Kindesunterhalt geltend. Die Ehe der Eltern ist rechtskräftig geschieden. Die Kinder leben bei ihrem Vater, der sie im vorliegenden Verfahren vertritt. In der Vergangenheit fanden Umgangskontakte zwischen Mutter und Kindern in wechselndem Umfang statt. Die künftige Regelung von Umgangskontakten ist zwischen den Eltern streitig.
Die Antragsteller machten im Juni 2022 Unterhalt geltend. Sie erhielten zeitweilig Unterhaltsvorschussleistungen sowie einen einmaligen Kinderbonus im Juli 2022. Die Antragsgegnerin stammt aus der Ukraine. Dort hat sie ein Studium der Ökonomie abgeschlossen. Der Abschluss wird in Deutschland nicht anerkannt. Die Antragsgegnerin schloss im Juni 2022 eine dreijährige Ausbildung zur Steuerfachgehilfin ab. Seitdem arbeitet sie in diesem Beruf, zunächst mit 30 Wochenstunden, seit September 2022 mit 40 Wochenstunden. Im März 2022 nahm sie ihre wegen des Krieges in der Ukraine nach Deutschland geflüchtete Mutter in die von ihr gemietete Wohnung auf.
Die Antragsteller begehren für die Zeit ab Juni 2022 Unterhalt unter Abzug erhaltener Unterhaltsvorschussleistungen sowie die Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten. Die Beteiligten streiten über den Umfang der Leistungsfähigkeit der Antragsgegnerin, insbesondere die Zurechnung fiktiver Einkünfte aus einer Nebentätigkeit sowie die Berücksichtigung von Ersparnissen wgen des Zusammenlebens mit ihrer Mutter.
Das AG verpflichtete die Antragsgegnerin ab Februar 2023 zur Zahlung eines im Wege der Mangelfallberechnung gekürzten Unterhalts von mtl. 330 € für jedes Kind und von Unterhaltsrückständen sowie zur Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten. Das OLG setzte den Unterhalt auf mtl. rd. 170 € je Kind für Februar bis April 2023 und je 180 € ab Mai 2023 herab, abzgl. für Februar bis Juli 2023 erbrachter Zahlungen. Den Unterhaltsrückstand und den Betrag für die Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten korrigierte es ebenfalls nach unten. Die Rechtsbeschwerden der Antragsteller hatten vor dem BGH keinen Erfolg.
Die Gründe:
Das OLG hat rechtsfehlerfrei den Mindestbedarf nach § 1612 a Abs. 1 BGB zugrunde gelegt. Es ist aber auch zu Recht von einer nur eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Antragsgegnerin nach § 1603 BGB ausgegangen, welche auch im Rahmen der gesteigerten Unterhaltspflicht nach § 1603 Abs. 2 Satz 1 BGB für den vollen Mindestunterhalt (abzgl. des hälftigen Kindergelds) nicht ausreicht.
Dass das OLG der Antragsgegnerin neben dem (teils fiktiven) Einkommen aus einer Vollzeittätigkeit als Steuerfachgehilfin kein fiktives Einkommen aus einer Nebentätigkeit zugerechnet hat, ist nicht zu beanstanden. Zwar kann die gesteigerte Unterhaltspflicht grundsätzlich auch eine Obliegenheit des Unterhaltspflichtigen begründen, über eine vollschichtige Arbeitstätigkeit hinaus auch eine Nebentätigkeit auszuüben. Nach der Rechtsprechung des Senats ergeben sich aber Grenzen der vom Unterhaltspflichtigen zu verlangenden Tätigkeiten etwa aus den Vorschriften des Arbeitsschutzes und dürfen die Anforderungen unter den Umständen des Einzelfalls insbesondere nicht dazu führen, dass eine Tätigkeit trotz der Funktion des Mindestunterhalts, das Existenzminimum des Kindes zu sichern, unzumutbar erscheint.
Die Beurteilung des OLG entspricht diesen Maßstäben. Dieses ist aufgrund der vorgelegten Schreiben des Arbeitgebers und der im Arbeitsvertrag getroffenen Regelungen davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber einer Nebentätigkeit nicht die nach dem Arbeitsvertrag erforderliche Zustimmung erteilt. Dass das OLG anders als das AG in den Schreiben des Arbeitgebers mangels entsprechender tatsächlicher Anhaltspunkte keine bloßen Gefälligkeitsbescheinigungen gesehen hat, bewegt sich innerhalb zulässiger tatrichterlicher Beurteilung und ist nicht zu beanstanden. Das OLG hat es in Anbetracht der Umstände des vorliegenden Falls rechtsfehlerfrei für unzumutbar gehalten, dass die Antragsgegnerin gegen ihren Arbeitgeber gerichtlich vorgeht oder nach einem anderen Arbeitgeber sucht, der eine Nebentätigkeit möglicherweise erlaubt. Dagegen spricht vielmehr nachvollziehbar, dass sie Berufsanfängerin ist und noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat. Unter diesen Umständen genügt die Antragsgegnerin mit der angetretenen Vollzeitstelle jedenfalls bezogen auf den maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der letzten Tatsacheninstanz auch den Anforderungen der gesteigerten Unterhaltspflicht nach § 1603 Abs. 2 Satz 1 BGB.
Das OLG hat bei der Bemessung der Leistungsfähigkeit der Antragsgegnerin wegen ihrer gesteigerten Unterhaltspflicht gegenüber den minderjährigen Antragstellern nach § 1603 Abs. 2 Satz 1 BGB den notwendigen Selbstbehalt zugrunde gelegt. Ob der notwendige Selbstbehalt wegen einer im Einzelfall gegenüber dem einkalkulierten Betrag geringeren Belastung des Unterhaltspflichtigen mit Wohnkosten im Fall einer Wohngemeinschaft zu reduzieren ist, ist umstritten. Zum Teil wird befürwortet, die für das Zusammenleben mit einem (leistungsfähigen) Partner allgemein angenommene Reduzierung des Selbstbehalts auch auf eine Wohngemeinschaft anzuwenden. Übereinstimmend mit dem OLG hält eine andere Auffassung die Kürzung des Selbstbehalts für nicht gerechtfertigt. Die letztgenannte Auffassung trifft zu.
Die vom OLG für seine Unterhaltsberechnung vorgenommene Ermittlung des von der Antragsgegnerin aus Erwerbstätigkeit erzielten Einkommens ist nicht zu beanstanden. Die Rechtsbeschwerde hat hierzu auch keine Einwendungen erhoben. Aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Antragsgegnerin wirkt sich die Erhöhung des Mindestunterhalts nach § 1612 a Abs. 1 BGB ab 1.1.2024 im Ergebnis nicht aus. Die vom OLG durchgeführte hälftige Anrechnung des im Juli 2022 gezahlten Kinderbonus auf den Unterhalt ist zutreffend. Sie ergibt sich aus § 1612 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB und beruht auf der gesetzlichen Einordnung des Kinderbonus als Kindergeld nach § 66 Abs. 1 Satz 2 EStG in der vom 28.5.2022 bis 31.12.2022 geltenden Fassung bzw. § 6 Abs. 3 Satz 1 BKGG.
Mehr zum Thema:
Kommentierung | BGB
§ 1603 Leistungsfähigkeit
Hammermann in Erman, BGB, 17. Aufl. 2023
09/2023
Kommentierung | BGB
§ 1612b Deckung des Barbedarfs durch Kindergeld
Hammermann in Erman, BGB, 17. Aufl. 2023
09/2023
Aktionsmodul Familienrecht
Online-Unterhaltsrechner mit den aktuellen Werten der Düsseldorfer Tabelle.Top Inhalte online: FamRZ und FamRZ-Buchreihe von Gieseking, FamRB von Otto Schmidt, „Gerhardt“ von Wolters Kluwer und vielen Standardwerken. Selbststudium nach § 15 FAO: Regelmäßig mit Beiträgen zum Selbststudium mit Lernerfolgskontrolle und Fortbildungszertifikat. Hilfreiches Berechnungstool: Unterhaltsrechner/Zugewinn/Versorgung. 4 Wochen gratis nutzen!